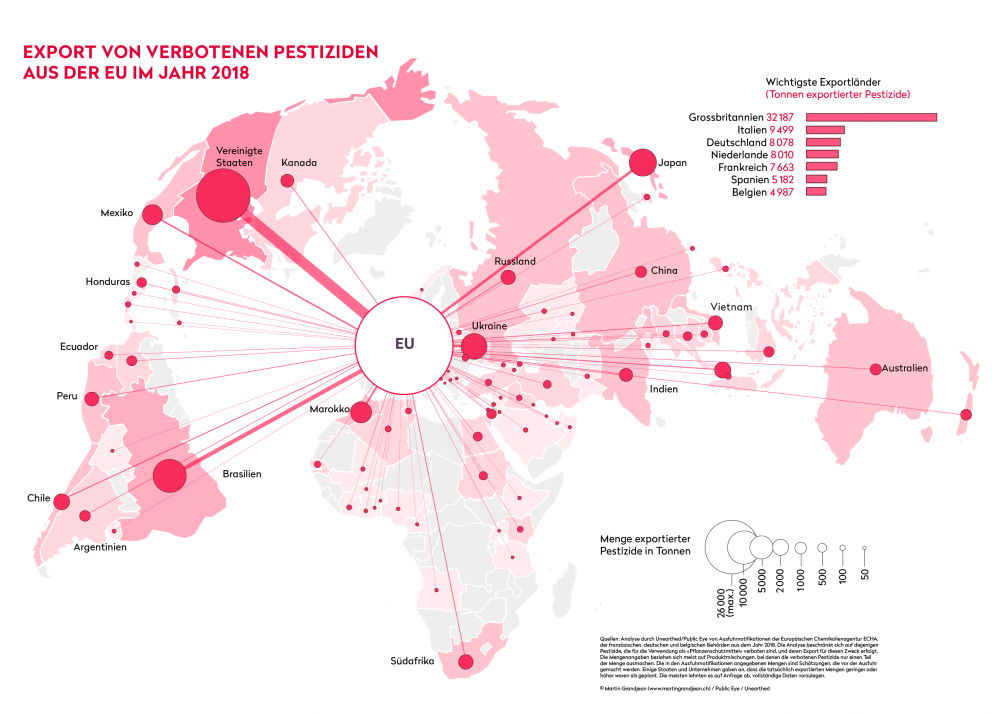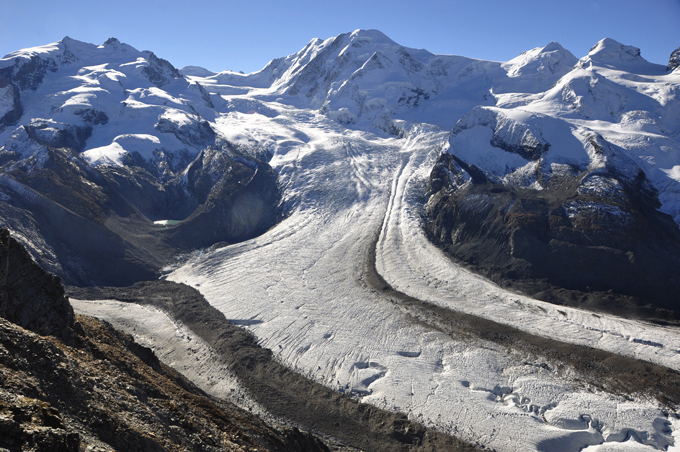Bern, 18.11.2020 – Der Bundesrat beschloss an seiner Sitzung vom 18. November 2020, das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) für die kommenden zwei Jahre im gleichen Ausmass wie bisher zu unterstützen. Die Schweiz will die von der UNRWA eingeleiteten Managementreformen weiter unterstützen und eng begleiten. Mit ihrem Beitrag von 40 Millionen Franken trägt die Schweiz dazu bei, die prekäre humanitäre Situation zu lindern, Perspektiven zu schaffen, das Risiko einer Radikalisierung junger Leute zu reduzieren und die Stabilität in der Region zu verbessern.
Wie schon vom Bundesrat in der MENA-Strategie 2021–2024 bestätigt, ist die Instabilität im Nahen Osten eine grosse Herausforderung, lokal, international, aber auch für die Schweiz. Der 2011 ausgebrochene Syrien-Konflikt und die andauernde Blockade des Gazastreifens haben dramatische Konsequenzen für die Palästina-Flüchtlinge, sowohl in Syrien und Gaza wie auch in den Nachbarländern. 95 Prozent der Palästina-Flüchtlinge, die sich noch in Syrien befinden, sind auf humanitäre Hilfe durch die UNRWA angewiesen. Die Covid-19-Pandemie verschärft die Lage der Palästina-Flüchtlinge zusätzlich und stellt die UNRWA vor neue Herausforderungen.
Mit ihrem Beitrag an die UNRWA unterstützt die Schweiz das Hilfswerk dabei, seine Aufgabe trotz der derzeit schwierigen Bedingungen weiterzuführen. Der jährliche Beitrag der Schweiz an das Budget der UNRWA bleibt mit diesem Entscheid für die nächsten zwei Jahre auf dem bisherigen Niveau von rund 20 Millionen Franken pro Jahr. Er ist jedoch vorderhand beschränkt auf die nächsten zwei Jahre und wird nicht wie üblich für vier Jahre, also bis Ende 2024, gesprochen. Mit diesem Vorgehen nimmt die Schweiz weiter aktiv Einfluss auf die Politik und Arbeitsweise der UNRWA. Seit 2005 ist die Schweiz Mitglied der beratenden Kommission der UNRWA, welche den Auftrag hat, den Generalkommissar des Hilfswerks bei der Umsetzung seines Mandates zu unterstützen. Die Schweiz macht sich stark für die strukturellen Reformprozesse der UNRWA sowie die 2019 eingeleiteten Reformen auf Managementebene, damit das Hilfswerk sein Mandat erfüllen und die zur Verfügung gestellten Gelder effizient eingesetzt werden können.
Der Beitrag der Schweiz soll in erster Linie den Programmen der UNRWA zukommen, welche Palästina-Flüchtlingen den Zugang zu Bildung, Gesundheitsvorsorge und sozialen Dienstleistungen ermöglichen. Über die Hälfte des Budgets der UNRWA wird im Bereich der Bildung aufgewendet. An den 711 Schulen des Hilfswerks werden aktuell über eine halbe Million Kinder unterrichtet. Dadurch schafft die UNRWA Perspektiven und trägt dazu bei, das Risiko einer Radikalisierung junger Leute zu reduzieren. Die Abgängerinnen und Abgänger der durch die UNRWA angebotenen und zertifizierten Berufsbildung sind auf dem regionalen Arbeitsmarkt gesuchte Fachkräfte. Nach Ausbruch der COVID-19-Pandemie ergriff die UNRWA verschiedene Massnahmen, damit die Schülerinnen und Schüler nach wie vor vom Bildungsangebot profitieren können, beispielsweise durch E-Learning. Die UNRWA betreibt zudem 144 Gesundheitszentren in der Region, in denen 3,6 Millionen Palästina-Flüchtlinge pro Jahr Zugang zu qualitativ hochstehenden Gesundheitsdienstleistungen erhalten. Das Hilfswerk gewährt ausserdem rund 270 000 Palästina-Flüchtlingen Unterstützung in Form von Nahrungsmitteln oder gezielte Bargeldunterstützungen.
Seit der Gründung im Jahr 1949 ist die UNRWA eine der wichtigsten von der Schweiz finanzierten multilateralen Organisationen im Nahen Osten und ein wichtiger Faktor für Stabilität in der Region. Philippe Lazzarini, seit März 2020 Generalkommissar der UNRWA, ist einer der ranghöchsten Schweizer bei den Vereinten Nationen.